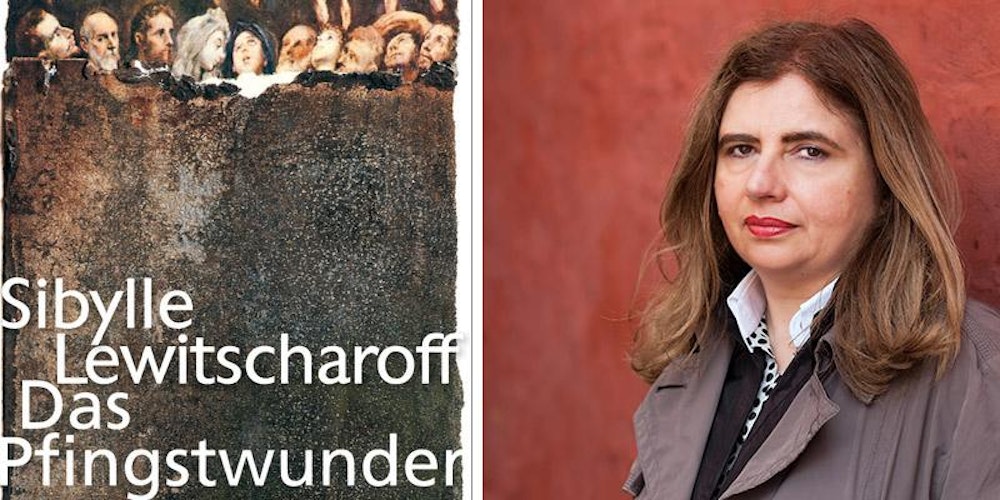Landschaften nach der Schlacht
»Landschaften nach der Schlacht« von Juan Goytisolo ist ein im Jahr 1982 erschienener Roman des spanischen Schriftstellers Juan Goytisolo. Der Titel des Romans ist allerdigns etwas irreführend: der Roman ist kein Schlachtengemälde, sondern ein stilvolles Selbstportrait. Darin negiert der innovative Autor so ziemlich alle politischen und moralischen Überzeugungen, als Homosexueller lässt er seine bürgerliche Herkunft ebenso hinter sich wie die katholische Religion, mit der er schon früh gebrochen hat.
Es handelt sich nicht um ein Geschehen, das sich mit handelnden Personen allmählich entfaltet. Vielmehr wird ein Protagonist erkennbar, der alles Mögliche tut, um den Wirklichkeitsgehalt seiner Aussagen zu verschleiern, dessen Aussagen überwiegend sarkastisch also indirekt sind, der in seiner Person solche Extreme vereinigt, dass es kaum möglich ist, ihn als ein einheitliches Ich zu erkennen und der vor allem seine Eindrücke vom Sentier-Viertel in den Vordergrund stellt (Sentier: gekennzeichnet durch eine chaotische Völkermischung, nur noch wenige Franzosen sind da, stattdessen findet eine für die Franzosen bedrohliche Überlagerung durch fremde ethnische Gruppen, Gebräuche, Zeichen statt).
Der Sprecher, der früher Korrespondent war und für sozialistische Ideale kämpfte, hat nicht mehr das Gefühl, ein gefestigtes Ego zu haben: "Mehr denn seine früheren Besuche als Korrespondent in den vielfältigen Spannungszentren dessen, was man unzutreffend Dritte Welt nennt, hat der lange Aufenthalt im Sentier unseren Helden die heilsamen Tugenden des Relativismus gelehrt. Wie der komplizierte, wundersame Mikrokosmos der Zellen birgt sein Viertel das universale Chaos. Eingetaucht in sein flüssiges Protoplasma hat der Schreiber nach und nach auf seine egozentrischen Anmaßungen verzichtet.
Von Mario Vargas Llosa als aufregendes apokalyptisches Werk bezeichnet, sprengt dieser innovative Roman die biederen bürgerlichen Vorstellungen in einer "Periode planetarischer Ungewissheit", hinterfragt gnadenlos wohlfeile gesellschaftliche Klischees. Schauplatz ist das zentrale Pariser Viertel Le Sentier, das ein Protagonist, erkennbar nur an der immergleichen Kleidung, als Flaneur ruhelos durchstreift.
Seine Identität bleibt fraglich, letzten Endes weiß er nicht mehr, ob er dieses abseitige Individuum ist, das seinen Namen usurpiert, oder ob dieser Goytisolo ihn eben erschafft. Die Perspektive wechselt unablässig zwischen dem auktorialen Erzähler, der seinen Protagonisten als pensionierten Schriftsteller schildert, und dem schrulligen Helden, dessen abartige Neigungen und sonstigen Spleens ebenso verstörend wirken wie seine fremdenfeindlichen Obsessionen.
Literatur [ >> ]:

Landschaften nach der Schlacht von Juan Goytisolo