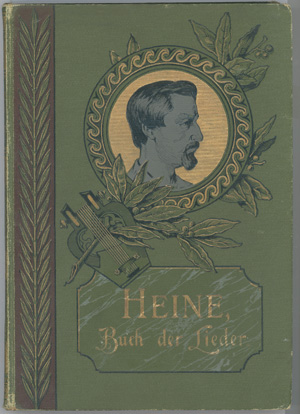William Shakespeares märchenhafte Liebesgeschichte, die gleichzeitig ein Verwirrspiel um Träume und Identitäten ist, gehört heute zu den meistgespielten Stücken des berühmten englischen Dramatikers. Theseus, Herzog von Athen, ist im Begriff Hippolyta zu heiraten, die Königin der Amazonen.
Noch vier Tage sind es bis zur Hochzeit. Diese Frist setzt er auch Hermia, die sich entscheiden muss, ob sie nach dem Willen ihres Vaters den ungeliebten Demetrius oder - unter Androhung des Todes - den von ihr heiß geliebten Lysander zum Mann nehmen will. Sie entscheidet sich für Lysander und flüchtet mit ihm in den Wald.
Ihre Freundin Helena, die ihrerseits und leider unerwidert Demetrius liebt, erzählt ihrem Angebeteten von Hermias Geheimnis - nur um ihm, der Hermia und Lysander eifersüchtig in den Wald folgt, ihrerseits in den Wald zu folgen. Hier treffen die vier auf Oberon und Titania, das tiefzerstrittene Elfenkönigspaar, und auf Oberons Diener Puck, der die vier Liebenden aus Athen mit einem Zaubersaft in tiefe Liebesverwirrungen stürzt.
Der Feenkönig Oberon und seine Gattin zürnen miteinander, leben voneinander getrennt, aber doch in ein und demselben Wald in der Nähe von Athen. In diesen Wald kommen zwei Liebespaare: Helena, die den Demetrius, Demetrius, der die Hermia, Hermia, die den Lysander, Lysander, der die Helena liebt.
Oberon erbarmt sich der Liebenden und lässt durch einen Diener Puck - nachdem dieser durch Schelmerei zuerst das Blatt gewendet und neue Verwirrungen angerichtet - durch einen Zaubersaft das Gleichgewicht herstellen.
|
Um diese Zeit soll auch am Hofe von Athen die Hochzeit des Theseus mit Hippolyta gefeiert werden. Der Handwerker Zettel kommt mit einigen Gesinnungsgenossen in den Wald, um ein Festspielt zu probieren, das bei der Hochzeitsfeier aufgeführt werden soll.
Puck vertreibt die Handwerker. Oberon benützt aber den einfältigen Zettel, seiner Gemahlin einen Streich zu spielen. Er lässt auf Titanias Augen von dem Liebeszaubersaft tröpfeln, und so hält die Feenkönigin den mit einem Eselskopf versehenen Zettel für einen Liebesgott. Schließlich löst Oberons Lilienstab alle Verwicklungen und Zaubereien. Theseus' Hochzeit wird gefeiert, die Handwerker führen ihre groteske Tragikomödie von Pyramus und Thisbe auf. Demetrius erhält Helena, Hermia den Lysander und Oberon selbst feiert mit Titania seine Versöhnung.
Wo man eben noch jemandem in Liebe zugetan war, liebt man mit einem Mal und wie von Zauberhand einen andern; wen man womöglich vorher hasste, den liebt man plötzlich. Und keiner weiß so recht, wie ihm geschieht im Strudel der gleichermaßen beängstigenden wie lustvoll-verführerischen, nächtlichen Geschehnisse, von denen am nächsten Morgen, bei helllichtem Tag, nur noch die vage Erinnerung an ein faszinierendes Traumgespinst bleibt.
Wenn man einem Werk das Signum - bzw. den Stempel - »Weltliteratur« aufdrücken kann, dann trifft dies zweifelsohne auf Shakespeares heitere Komödie zu. »Ein Sommernachtstraum« ist Komödie mit heiterem Zauber und dämonische Groteske zugleich. Shakespeare zieht alle Register seines Könnnes: Romantik, Witz und Poesie, Rausch und Entgrenzung, Märchenspuk, Rüpelposse und Liebesdrama - Shakespeare zieht in seinem Sommernachtstraum alle Register, um die Nacht- und Schattenseiten des allgemeinen Liebestaumels zu erhellen.
Weblink:
Ein Sommernachtstraum - www.klassiker-der-weltliteratur.de
Literatur:

Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare

Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare
Rezension:
Ein Sommernachtstraum Rezension von Joachim Weiser