Molière, Racine, Corneille, Boileau und La Fontaine - dies sind die
heute noch bekannten Vertreter der französischen Literatur des 17.
Jahrhunderts, das allgemein als das Klassische bezeichnet wird.
Molière und Racine standen dabei in einem besonderen Verhältnis
zueinander. In den Jahren 1663 bis 1665 wurde Molière für kurze Zeit zum
Protektor des noch unbekannten Nachwuchsdramatikers Jean Racine.
Er beauftragte ihn mit einer Tragödie über den Ödipus-Stoff, die er
Anfang 1664 unter dem Titel »La Thébaïde. Ou les frères ennemis« (»Die
Thebais. Oder die feindlichen Brüder«) wenig erfolgreich inszenierte.
1665 spielte er mit immerhin mäßigem Erfolg Racines Tragikomödie
»Alexandre le Grand«.
Molière erlebte allerdings, dass der mit der Inszenierung
unzufriedene Jungautor mit seinem Stück zu der Truppe des "Hôtel de
Bourgogne" abwanderte, die auf Tragödien spezialisiert war. Dabei nahm
Racine eine von Molières beliebtesten Schauspielerinnen mit,
Mademoiselle du Parc, die sich mit Racine liiert hatte und ihm zur
Konkurrenz folgte.
Das Verhältnis der beiden Männer war hiernach naturgemäß gespannt.
Molière rächte sich, indem er in der Folgezeit häufig ältere Stücke von
Racines Rivalen Pierre Corneille wieder aufnahm oder neue uraufführte.
Literatenwelt ist ein Literatur-Blog, der dem Leser interessante Einblicke und Neuigkeiten aus der Welt der Literatur und der Literaten bietet. Hier erhalten Sie regelmäßig Informationen über die Welt der Literaten und Bücher. Dieses Projekt ist ein Forum für Literatur-Nachrichten, Veröffentlichungen und Rezensionen.
Samstag, 18. April 2015
»Abendlicht« von Stephan Hermlin

Abendlicht
Stephan Hermlin, ein bedeutender Dichter und Kulturfunktionär der DDR, hält Rückschau auf sein Leben und verklärt seine eigene Sage mild im Abendlicht - einem Epos der Verklärung.
Der sozialistische "homme de lettre" erinnert sich an Beobachtungen und Erfahrungen eines jungen Mannes aus gebildeter bürgerlicher Familie, der auf der Straße zum Kommunisten wird und so beides aus fremder Nähe wahrnimmt. An das Großbürgertum, das die heraufkommenden Nazis als barbarische Horde abtut, und die Arbeiter, die sich hilflos und oft schwankend widersetzen.
Im Zentrum des Interesses stehen nicht Natur oder Kunst, sondern die politischen Entwicklungen in der ausgehenden Weimarer Republik und in der Zeit der Etablierung der nationalsozialistischen Herrschaft. Ein Angelpunkt ist dabei der 1931 erfolgte Eintritt des Erzählers in den kommunistischen Jugendverband, der zu einem weitgehenden Bruch mit seinem großbürgerlichen Umfeld führt.
Dieser Schritt wird zwar durch das Versagen des Bürgertums gegenüber dem aufkommenden Faschismus plausibel gemacht, jedoch die Widersprüche zwischen dem weiterhin künstlerisch ambitionierten Ich-Erzähler und den Anforderungen der damals an Stalin orientierten kommunistischen Organisationen nicht immer schlüssig glattgezogen.
Als "sozialistischer Grandseigneur" hatte er an seinem bürgerlichen Literaturgeschmack festgehalten und in seiner "Abendlicht"-Prosa Stimmungen wie diese beschworen:
|
Ein Dokument aus heroischer Zeit der Kämpfe zwischen Himmel und Hölle, kommunistischer Utopie und babarbarischem Faschismus, sollte den Lesern hüben und drüben vor Augen führen, dass es damals nicht so einfach war, ein äußerst guter, tadelloser Mensch zu sein, der sich eindeutig von allem Bösen abhalten und abgrenzen konnte. Und doch schien genau das geglückt im Lebenslauf des Stefan Hermlin.
Er war zwar ein Freund Erich Honneckers und hielt felsenfest zum Regime der DDR, aber er konnte es sich deshalb auch leisten, gegen die Ausbürgerung Biermanns zu protestieren. Als wollte er damit sagen, wenn ihr dem Regime genügend Appllaus spendet, dann duldet es auch eure Kritik hin und wieder. Seiner Tochter, sie war längst an sich für den diplomatischen Dienst vorgesehen, aber sie wurde auch ein Groupie von Biermann, wollte genau das nicht gelingen, drum musste auch sie nicht fliehen, doch mit Möbelwagen als persona non grata ausgebürgert werden.
Als die Sage seines Lebens, zwischen Bericht und schön geschriebener Parabel 1979 unter dem Titel "Abendlicht" bei Wagenbach erschien, war das Feuilleton in Ost und West gleichermaßen begeistert.
Weblinks:

Abendlicht von Stephan Hermlin
Dichtung und Wahrheit: Zum Fall Stephan Hermlin - www2.dickinson.edu
Dienstag, 14. April 2015
Günter Grass ist gestorben
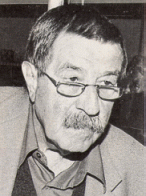
Der Schriftsteller Günter Grass ist im Alter von 87 Jahren in Lübeck gestorben. Das teilte der Steidl Verlag in Göttingen mit. Grass gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller zeitgenössischer Literatur und wurde für sein Werk 1999 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
Der Schriftsteller wurde von der Jugend in seiner Heimatstadt Danzig entscheidend geprägt. Sein literarisches Werk ist eng mit der alten Hansestadt Danzig verbunden. Grass hat die Erlebnisse seiner Jugend in seiner Heimatstadt literarisch dahingehend verewigt, dass sie in seinem späteren Leben zur Literatur geworden sind. Er schaffte es, die Erlebnisse in seiner Heimatstadt in ein literarisches Kosmso zu verwandeln.

Seine Romane und Erzählungen zeigen zeitkritische, naturalistische, groteske und oft provozierende Züge. Besonders bekannt wurden seine Romane »Die Blechtrommel« (1959) und »Hundejahre« (1963), die Erzählung »Katz und Maus« (1961) sowie die Romane »Der Butt«, »Die Rättin« und »Im Krebsgang«.

Mit seinem ersten Roman »Die Blechtrommel« gelang dem damals 31-jährigen der Durchbruch auf dem Literaturmarkt. Der Roman repräsentiert ein Stück deutscher Zeigeschichte, denn der Roman umspannt die fünf Jahrzehnte von 1899 bis in die Anfänge der Bundesrepublik. Auch ist der Krieg ist allgegenwärtig. Im seinem Werk thematisiert er die kollektive Verdrängung der Zeit während des Dritten Reiches durch die deutsche Bevölkerung. Es ging ihm auch um eine Kritik an der mangelnden Aufarbeitung.
Held des Romans ist der boshaft tabulose Oskar Matzerath, ein Gnom, der mit drei Jahren beschließt, nicht weiter zu wachsen, um im Kindskörper vor allerhand Strafen geschützt zu sein, Matzerath, der kreischt und trommelt und nicht wachsen will in der Nazi-Umgebung, wird durch die Spuren der Realitätsverweigerung gezeichnet.
Grass verfasste auch mehrere Bühnenstücke, von denen das »Deutsche Trauerspiel« und »Die Plebejer proben den Aufstand« Grass' Auffassung von der gesellschaftlichen Verantwortung des Literaten wiederspiegelt.
Wie kein anderer Autor deutscher Sprache nach 1945 steht Günter Grass für den mühsamen, vielleicht nie abzuschliessenden Vorgang des Verstehenwollens, wie der deutsche Abstieg in die Barbarei von 1933 bis 1945 möglich war.
Wie keinem anderen deutschen Autor ist es Günter Grass gelungen, hauptsächlich in seiner Danziger Trilogie - Katz und Maus bestehend aus den Romanen »Die Blechtrommel« (1959), »Hundejahre« (1963) und der Novelle »Katz und Maus« als Abschluss der »Danzig-Trilogie« - die Nazijahre erzählend in seiner Ambivalenz zu spiegeln. In jener Ambivalenz, die sich zusammensetzte aus aus Verbrechen und Alltäglichkeit, Aufschwung und Niederlage, völkische Begeisterung und desillusionierter Verzweiflung.

Günter Grass hat sich nicht auf das Erzählen beschränkt und engagierte sich aktiv in der Politik - bis hin zum Wahlkampf für Willy Brandt. Er mischte sich zuweilen auch in die politische Diskussion ein, was ihm jedoch nicht immer nur Beifall einbrachte.
Grass gilt als ein politischer Schriftsteller und Intellektueller. Er gehört eindeutig zum Typus des sich einmischenden Schriftstellers. Grass hat sich in den 80er-Jahren im Zusammenhang mit seinem Engagement für die Friedensbewegung, zum »Gewissen der Nation« bis hin zum Wunscharchitekten der Wiedervereinigung emporgehoben.
Sein Ruf als Schriftsteller von Weltrang, erlaubte es ihm, sich politisch einzumischen. Grass verstand sich als politischer Schriftsteller, der sich einmischt und der gern hart urteilt. Er mischte sich auch bis ins hohe Alter in politische Debatten ein. Sein moralischer Rigorismus machte ihn jedoch angreifbar. Grass polarisierte und erhob sich gerne zum schlechten Wissen der Nation. - Nun ist seine Stimme verstummt, der Nationaldichter schweigt für immer. Der Trommler ist gegangen, die Tommel ist verstummt.
Weblinks:
Günter Grass-Biografie - Biografien-Portal www.die-biografien.de
Günter Grass-Zitate - Zitate-Portal www.die-zitate.de
Montag, 13. April 2015
Stephan Hermlin 100. Geburtstag

Stephan Hermlin wurde vor 100 Jahren am 13. April 1915 in Chemnitz geboren. Hermlin - eigentlich Rudolf Leder - war ein deutscher Schriftsteller, Übersetzer und ein einflußreicher Kulturfunktionärin der DDR. Stephan Hermlin gilt als einer der anerkannten und wichtigsten Schriftsteller der DDR. Er verstand sich als Mittler zwischen Literatur und Politik. Als "sozialistischer Grandseigneur" hatte er an seinem bürgerlichen Literaturgeschmack festgehalten.
Er trat als Erzähler, Lyriker, Übersetzer, Herausgeber und prononcierter Kritiker ebenso in Erscheinung wie als Verfasser von Reportagen, eines Hörspiels und einer Nacherzählung. Hermlin stach durch seine Erzählungen, Essays und Lyrik hervor und war einer der bekanntesten Schriftsteller der DDR. Sein Werk erstreckt sich über zahlreiche Gattungen. Darüber hinaus wirkte er im Rundfunk. Einige seiner Erzählungen wurden durch die DEFA verfilmt.
1931 schloß er sich den Kommunisten an, arbeitete nach 1933 drei Jahre im Untergrund, bevor nach Frankreich emigrierte und sich der Résistance anschloss. Nach dem Krieg kehrte er nach Deutschland zurück, zunächst nach Frankfurt am Main, wo er als Rundfunkredakteur arbeitete. Seit 1947 lebte Hermlin in Ost-Berlin und war Mitarbeiter in den Zeitschriftenredaktionen der „Täglichen Rundschau“ (Tageszeitung der Sowjetischen Militäradministration), von „Ulenspiegel“, „Aufbau“ sowie „Sinn und Form“.
Hermlin arbeitete in wichtigen Gremien der sowjetischen Besatzungszone und wurde nach 1949 schnell einer der einflussreichsten Schriftsteller der neu gegründeten DDR. Der Lyriker, Prosaautor und Übersetzer - unter anderem Nerudas und Aragons - wurde rasch einer der wichtigsten DDR-Autoren, der als Mitglied des PEN und als Teilnehmer vieler Kongresse auch international sehr präsent war.
1949 schrieb er sein berühmtes Gedicht "Die Asche von Birkenau", das von Günter Kochan vertont wurde. Als enger Freund von Erich Honecker verstand sich Hermlin zu dieser Zeit als Protagonist sozialistischer Kulturpolitik, engagierte sich aber auch als Mittler zwischen Literatur und Politik.
1976 gehörte Hermlin zu den Initiatoren des Protestes prominenter Schriftsteller gegen die Ausweisung von Wolf Biermann. Nach seinem Engagement für Wolf Biermann erhielt Stephan Hermlin eine strenge Parteirüge und wurde fortan noch gründlicher von der Stasi überwacht. Er wurde jedoch nicht aus der SED ausgeschlossen und äußerte sich weiterhin als überzeugter Kommunist.
Als die Sage seines Lebens, zwischen Bericht und schön geschriebener Parabel 1979 unter demn Titel "Abendlicht" bei Wagenbach erschien, war das Feuilleton in Ost und West gleichermaßen begeistert.
Gegen die offizielle Politik der Ost-West-Konfrontation organisierte Hermlin im Dezember 1981 die Berliner Begegnung zur Friedensförderung, ein deutsch-deutsches Schriftstellertreffen.
Hermlin war Mitglied des Schriftstellerverbandes der DDR, der Akademie der Künste der DDR und seit 1976 auch der Akademie der Künste West-Berlin. Hermlin engagierte sich in zahlreichen Gremien und Vorständen aktiv auf dem kulturpolitischen Felde und in der internationalen Friedensbewegung.
Er bekleidete zeitweise einflußreiche Positionen im Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR, als Sekretär der Sektion Dichtkunst und Sprachpflege in der Akademie der Künste der DDR und als Vizepräsident des internationalen PEN.
Stephan Hermlin starb am 6. April 1997 in Berlin. Bei seinem Tod im April 1997 rief man ihm nach, er sei "der letzte Kommunist" des 20. Jahrhunderts gewesen, wenn allerdings nur noch als "literarisierte Erscheinung". Den Untergang der DDR erlebte er als Trauma. Wie schwer Hermlin das Wendejahr 1989 getroffen hatte und wie sehr er den Untergang der DDR als Scheitern seines persönlichen Lebens empfand, gab er kurz vor seinem Tod auch zu.
Weblinks:
Stephan Hermlin - www.hermlin.de
Dichtung und Wahrheit: Zum Fall Stephan Hermlin - www2.dickinson.edu
Literatur:

In den Kämpfen dieser Zeit von Stephan Hermlin

Abendlicht von Stephan Hermlin
Samstag, 11. April 2015
Die Amseln haben Sonne getrunken
Die Amseln haben Sonne getrunken,
aus allen Gärten strahlen die Lieder,
in allen Herzen nisten die Amseln,
und alle Herzen werden zu Gärten
und blühen wieder.
Nun wachsen der Erde die großen Flügel
und allen Träumen neues Gefieder;
alle Menschen werden wie Vögel
und bauen Nester im Blauen.
Nun sprechen die Bäume in grünem Gedränge
und rauschen Gesänge zur hohen Sonne,
in allen Seelen badet die Sonne,
alle Wasser stehen in Flammen,
Frühling bringt Wasser und Feuer
liebend zusammen.
Max Dauthendey
aus allen Gärten strahlen die Lieder,
in allen Herzen nisten die Amseln,
und alle Herzen werden zu Gärten
und blühen wieder.
Nun wachsen der Erde die großen Flügel
und allen Träumen neues Gefieder;
alle Menschen werden wie Vögel
und bauen Nester im Blauen.
Nun sprechen die Bäume in grünem Gedränge
und rauschen Gesänge zur hohen Sonne,
in allen Seelen badet die Sonne,
alle Wasser stehen in Flammen,
Frühling bringt Wasser und Feuer
liebend zusammen.
Max Dauthendey
»Nathan der Weise« von Gotthold Ephraim Lessing

Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen
»Nathan der Weise« ist ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen von Gotthold Ephraim Lessing. Das dramatische Gedicht spielt in Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge, wo die drei Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Das fünfaktige Ideendrama von Gotthold Ephraim Lessing wurde 1779 veröffentlicht und am 14. April 1783 in Berlin uraufgeführt. Das Werk hat als Themenschwerpunkte den Humanismus und den Toleranzgedanken der Aufklärung.
Seine angenommene Tochter Recha unterrichtet er statt im Judentum oder im Christentum, in Menschlichkeit. Eine Einstellung, die, als ein jeder unter dem Deckmäntelchen seiner Religion davon überzeugt ist, er vertrete die einzig wahren Werte, zwangsläufig zu Konflikten führen muß. Zu groß ist die Zahl der Intoleranten und Ignoranten.
Inmitten eines dramatischen Geschehens um die Rettung seiner Tochter durch einen christlichen Ordensritter, den seinerseits der Sultan vor dem Tod bewahrt hat, steht Nathan der Weise als ruhender Pol der Vernunft, Aufklärung und Toleranz.
Nathan kann seine Anschauung in der berühmten »Ringparabel« verdeutlichen: So, wie sich die drei exakt gleichen Ringe nicht unterscheiden lassen, so kann auch unter den Religionen von Juden, Christen und Moslems nicht entschieden werden, welche von ihnen den echten Glauben darstellt. Am Ende kann Nathan die Zweifler von seiner Haltung überzeugen. Dafür benötigt der Weise nicht mehr als zwei Stunden. Im Spiel auf der Bühne.
In der berühmten Ringparabel klärt der Lehrmeister die heikle Frage nach der wahren Religion. Keine der drei Weltreligionen ist absolut. Jede erweist ihre Wahrheit und ihren Sinn erst durch die Kraft, mit der sie praktische Humanität stiften kann. Nathan gelingt es, die Menschen verschiedenen Glaubens in friedvollem Miteinander als Angehörige einer großen Familie zu vereinen.
Das Stück ist eine Parabel auf die Menschlichkeit: Toleranz und Menschlichkeit, das sind die höchsten Güter der Zivilisation. Die zeitlose Parabel ist in Zeiten zunehmender religiöser Intoleranz von beklemmender Aktualität. Heute - am Ende des 20. Jahrhunderts - ist unsere Lebenswirklichkeit noch immer voll Intoleranz und Ignoranz. Und wir haben es immer noch nötig, erklärt zu bekommen, welches die eigentlichen Werte unserer Gesellschaft sind.
Literatur:

Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen
von Gotthold Ephraim Lessing
Samstag, 4. April 2015
»Max und Moritz« erblicken das Licht der Welt

Max und Moritz
Eine Bubengeschichte in sieben Streichen
Jubiläumsausgabe
Max und Moritz, die berühmtesten lausbübischen Brüder der Literaturgeschichte, erblickten am 4. April 1865 das Licht der Welt. Max und Moritz ist eine Lausbuben-Geschichte in sieben Streichen. Die Geschöpfe von Wilhelm Busch waren bei Erscheinen ein lokales Münchener Literaturereignis.
Als Max und Moritz im Jahre 1865 veröffentlicht wurde, erahnte noch keiner die Erfolgsgeschichte des Bilderbuchs. Heute gehören die sieben Streiche der bösen Buben zu den Meisterwerken von Wilhelm Busch. Wer erinnert sich nicht an die haarsträubenden Geschichten, wie z.B. diejenige vom armen Onkel Fritz, der mit Maikäfern geplagt wird.
Sein berühmtes Werk ist ein glanzvolles und treffliches Gesellenstück in Ironie - eine Mischung aus Dichtkunst, heiterer Ironie und pointiert witziger Zeichnung. Busch hatte mit den lustigen Gesellen Ironisches im Sinn.
Die beiden schelmenhaften Lausbuben sind aber keineswegs auf den ersten Blick erkennbare böse Kinder, sondern lustig-nette Lausbubengesichter. Und genau das war es, was Wilhelm Busch sein wollte: ironisch. Eine Satire, zum einen auf die damaligen Kinderbücher, die alle lieb und brav gewesen sind, wie auch als Satire auf das Spießbürgertum.
Wenn man von Schaffensperioden bei Busch spricht, so sind das allgemein drei. Die ersten Beiträge in den Zeitschriften Fliegende Blätter und Münchener Bilderbogen. Zunächst noch Karikaturen, Zeichnungen für fremde Texte. Dann erste eigene Texte und Bildergeschichten.
»Max und Moritz« bildet den Höhepunkt dieser ersten Periode und zugleich den Übergang zum zweiten Lebensabschnitt. Anlässlich des 150. Geburtstages am 4. April 1865 von »Max und Moritz« hat nun eine Jubiläumsausgabe das Licht der Welt erblickt.
Weblink:

Max und Moritz - Eine Bubengeschichte in sieben Streichen, Jubiläumsausgabe
von Wilhelm Busch
Abonnieren
Kommentare (Atom)