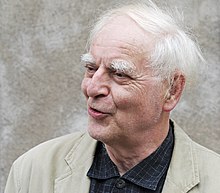Honoré de Balzac wurde am 20. Mai 1799 in Tours als Sohn eines Beamten geboren. Honoré de Balzac war ein berühmter französischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Er ist die Verkörperung des Literaturberiebes der Restaurationszeit in Frankreich.
Im Juli 1819 quittierte der junge
Balzac sein Jurastudium und die bereits begonnen Lehre bei einem Notar.
Seine schriftstellerische Tätigkeit begann er mit Kolportageromanen, die er in den 1820er Jahren unter Pseudonym herausbrachte. 1829 ließ er erstmals ein Buch unter seinem eigenen Namen erscheinen.
Mit dem Roman Der letzte Chouan, der die Royalistanaufstände in der Bretagne von 1799/1800 zum Thema hat, begann die Erfolgsserie seiner großen Gesellschaftsromane, die er in manischer Fronarbeit vcrfasste. Dabei ruinierte Balzac zwar seine Gesundheit, vernachlässigte hingegen nie seinen strikt realistischen Erzählstil, der für die nächsten Schriftstellergenerationen weit bis ins 20. Jahrhundert hinein zum Vorbild wurde.
Er hat erkannt, daß es nicht nur darum geht, auf einen Schlag berühmt zu werden und daß er einer Illusion nachgelaufen ist. Es geht vor allem darum, hart zu arbeiten und Geld zu verdienen, um nicht zurück zu müssen in die elterliche Abhängigkeit. Er muß also mit dem Schreiben Geld erwirtschaften, er muß etwas schreiben, womit er rasch Erfolg hat. Und er geht bei seinen Überlegungen davon aus, daß das Publikum Romane will, in denen aufregende, grelle, romantische, abenteuerliche Schicksale beschrieben werden. Daher entschließt er sich, mit dem romantischen Zeitgeist zu gehen.
Balzacs Erzählweise gilt in der Literaturgeschichte als prototypisch für den traditionellen Roman "à la Balzac”, d. h. einen Roman mit interessanten, nicht eben Durchschnittstypen verkörpernden Protagonisten, einer interessanten und mehr oder minder zielstrebigen Handlung sowie einem eindeutigen Vorherrschen der auktorialen Erzählsituation.
Seine Erzählweise, in der er die menschliche Gesellschaft gottgleich wie auf einer Bühne präsentiert und ausleuchtet, gilt als Inbegriff des auktorialen Erzählens. Für einige experimentelle Autoren des 20. Jahrhunderts (vor allem im französischen "nouveau roman") avancierte er dadurch zeitweise zum ästhetischen "Hauptfeind Nummer eins".
Seine sozial einfühlsamen Schilderungen sind nicht nur der Ausdruck des Realismus, sondern auch seiner Beobachtungsgabe. Mit scharfem Blick seziert er die Gesellschaft seiner Zeit.
Seine Themen waren und blieben die eines ketzerischen Protestanten - Schuld und Verrat, die unmögliche Gnade und die unmögliche Gerechtigkeit - die Realität nahm er nur so wahr, wie sie sich in sein Bild fügte: die Welt als Paradox, als Absurdum, als faszinierende Sinnlosigkeit. Sein Großformat bestand darin, dass er kurz und konsequent von sich auf die Welt schloss: Weil ihm die Form der Komödie gemäß war, dekretierte er, unserer Welt komme nur noch die Komödie bei.
Balzac verband die einzelnen Texte zu einem Zyklus, indem er viele Figuren mehrfach auftreten lässt. Mit dieser literarischen Innovation wollte er ein System schaffen, das seiner Intention entsprach, ein umfassendes Sittengemälde seiner Zeit zu entwerfen.

Balzac nannte die Gesamtheit seiner Romane die »Menschliche Komödie« (»La comédie humaine«) im Gegensatz zur »Göttlichen Komödie«
Dante Alighieris.

Die wichtigsten Bücher aus diesem unvollständig gebliebenen Werk mit 40 Bänden sind »Das Chagrinleder« (1831), »Vater Goriot« (1834/35), »Oberst Chabert« (1837), »Die Frau von dreißig Jahren«.
Balzac war ein Mann von außergewöhnlicher Vitalität und Schaffenskraft. Er war nicht nur Erzähler, sondern auch Journalist und gelegentlicher - allerdings recht erfolgloser - Dramatiker.
Honoré de Balzac starb am 18. August 1850 in Paris.
Weblinks: